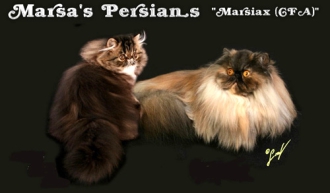biography of the artists
source Wikipedia the free encyclopedia
Seymour Joseph Guy (1824 – 1910), was an American romance painter.
He was born and trained in London but moved to New York City where he is known for genre works.He trained for four years with the portrait painter Ambrosini Jerôme and married the daughter of an engraver, Anna Maria Barber, before his move to New York in 1854. He was a member of the Sketch club and became friends with John George Brown, and they both began to paint genre works of children, probably inspired by their own, as Guy eventually had nine. He died at his home in New York on December 10, 1910.
Giulio del Torre
Lucio Rossi
- Léon Charles Huber, parisian artist was a talented painter of still-life and animal subjects. He specialized in painting cats, and it is noted he won various awards for them.
- Huber was born in Paris in 1858 and lived most of his life there. He studied painting at the l’Ecole des Beaux-Arts with P. Dawant and Jules Grün. From 1887 on, he exhibited yearly at the Society of French Artists
Hermann Volz, 1814 - 1894 Maler der Münchner Schule
Jacques-Laurent Agasse (* 24. April 1767 in Genf; † 27. Dezember 1849 in London) war ein Schweizer Tier- und Landschaftsmaler.
Agasse lernte den reichen George Pitt, zukünftiger Lord Rivers, kennen, mit dem er nach Grossbritannien reiste und die Englische Malerei entdeckte. Zurück in Genf, arbeitete Agasse zusammen mit seinen Jugendfreunden Firmin Massot und Wolfgang-Adam Töpffer. Sie malten gemeinsam reichbelebte Landschaften, wobei jeder den Teil beitrug, den er am besten konnte, Tiere, Menschen, Landschaften (z.B. Der Pferdemarkt in Gaillard). Zusammen mit Firmin Massot (1766–1849) und Wolfgang-Adam Töpffer (1766–1847) gehört Jacques-Laurent Agasse zu den wichtigsten Vertretern der Genfer Schule vom Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts.
1800 etablierte er sich mit der Unterstützung von Lord Rivers in London als Tiermaler. Er wurde bald berühmt für seine Pferde- und Hunde-Darstellungen. Er malte auch wilde und exotische Tiere, die er in den Londoner Menagerien beobachtete. Von 1801 bis 1845 stellte er regelmässig in der Royal Academy aus. Eines seiner hervorragendsten Werke ist Das Gestüt von Lord Rivers in Stratfield Saye (um 1806). Ab 1810 wohnte er bei George Booth, dessen Kinder im als Modell für Genrebilder dienten. Er hat auch Bilder von der Themse gemalt, Biologiepublikationen illustriert und sich später zeitweise der Porträtmalerei gewidmet. Agasse verdiente den Lebensunterhalt mit seiner Kunst, ist aber nie reich geworden. Er blieb zeitlebens Junggeselle.
Georg Friedrich Kersting (* 31. Oktober 1785 in Güstrow; † 1. Juli 1847 in Meißen) war ein deutscher Maler.
H. Gueralt
Karl von Blaas (* 28. April 1815 in Nauders; † 19. März 1894 in Wien) war ein österreichischer Historien- und Genremaler.
Karl von Blaas stammte aus armen Verhältnissen. Sein Onkel, Freiherr von Eschenburg, erkannte früh sein Malertalent und ermöglichte ihm den Besuch der Akademie in Venedig ab 1832. Nach den Studienjahren hielt er sich in Florenz und Rom auf und wurde hier durch Friedrich Overbeck stark beeinflusst. 1851 folgte er einem Ruf als Professor für Historienmalerei an die Akademie in Wien. In dieser Zeit malte er die Fresken in der Altlerchenfelder Pfarrkirche. 1855 erhielt er einen Preis bei der Weltausstellung in Paris für sein Gemälde „Karl der Große besucht die Schule der Knaben“. Im gleichen Jahr wurde er Professor an der Akademie zu Venedig.
Blaas war auch als Genre- und Porträtmaler tätig, bevorzugte selbst aber religiöse Motive. Auch die Fresken in der Kirche in Fót (Ungarn) stammen von Blaas. Zu seinen Schülern in Wien gehörte der Orientmaler Leopold Carl Müller. Seine Söhne Eugene de Blaas (1843–1931) und Julius von Blaas (1845-1922) waren ebenfalls Genre- und Historienmaler. Im Jahr 1895 wurde in Wien Döbling (19. Bezirk) die Blaasstraße nach ihm benannt
William Frederick Yeames (18 December 1835 – 3 May 1918) was a British painter best known for his oil-on-canvas problem picture 'And When Did You Last See Your Father?' , which depicts the son of a Royalist being questioned by Parliamentarians during the English Civil War.
Yeames married on 18 August 1865 Anne Winfield, daughter of Major James Stainbank Winfield of the East India Company. While their work was popular with the public, the St John's Wood Clique found it difficult to get their work displayed at prestigious galleries and the Royal Academy because it never received critical acclaim. Yeames managed to overcome this problem and from 1859 exhibited at the Royal Academy and was made an Associate (ARA) in 1866. Unlike other artist circles of the time, the St John's Wood Clique did not lead a bohemian lifestyle; Yeames took holidays at Hever Castle and lived comfortably in London. He and Goodall specialised in Tudor and Stuart subjects, but did not always portray the events they depicted with historical accuracy instead using them as inspiration. He died in Teignmouth, Devon on 3 May 1918.
John Thomas Peele (1822-1897) was a British painter specializing in portraits, landscapes, and genre scenes.
Born in Peterborough, Northamptonshire, Peele immigrated to America with his parents in about 1834. The family settled in Buffalo, New York, where Peele began painting. In 1840, he traveled to New York City to continue his artistic training and enrolled in the National Academy of Design's antique class. Peele remained in New York City for approximately eighteenth months and then settled in Albany, where he worked as a portrait painter for two years. From 1841 to 1844, Peele was in London attempting to launch a career as a society portraitist, but he failed to win substantial patronage. He returned to New York by 1845 and switched his focus to ideal genre subjects featuring children. The artist achieved some popularity with his sentimental compositions, eventually becoming a member of the National Academy of Design. In approximately 1851, he relocated to London. From 1852 to 1891, he exhibited at the Royal Academy, the British Institution, and the Society of British Artists, to which he was elected in 1872. During this period, his work was also featured in exhibitions held at the Royal Society of Artists in Birmingham and the Glasgow Institute of the Fine Arts.Although the artist kept a studio in London throughout the second half of his career, he spent extended periods in Liverpool, Douglas (Isle of Man), and Bexley Heath, Kent, where he maintained a second home after 1865. His career flourished during the last decades of his life. Prominent figures such as Prince Albert and the American landscape painter Frederick Edwin Church purchased several of his paintings and the dealers Messrs. Graves & Co. published engravings after his compositions.
William Clarke Wontner (17 January 1857 Stockwell, Surrey - 23 September 1930 Worcester), was an English portrait painter steeped in Academic Classicism and Romantic.
Wontner was born in Stockwell, Surrey, the son of noted architect, designer and renderer William Hoff Wontner (1814–1881) and Catherine Smith.
Under the tutelage of his father, Wontner worked with John William Godward (1861–1922), a noted exponent of what became known as Greco-Roman style. The two were destined to become great friends.
Wontner was a relatively minor painter who was part of the neo-classical movement in England, led by Alma-Tadema. His style favoured seductively languorous women against classical or oriental marbled backdrops. His faithfully rendered fabrics draped over patently European models, somehow created an air of Orientalism. His work was exhibited at the Royal Academy from 1879, at the Society of British Artists and at the Royal Institute of Painters in Water Colours. When the Grosvenor Gallery closed in 1890, Wontner exhibited at the New Gallery.
Wontner married Jessie Marguerite Keene (1872–1950), daughter of Charles Joseph Keene, on 7 June 1894 at St. Dominic's Priory Church, Naverstock Hill in Hampstead. The couple had no children. Wontner was buried on 26 September 1930 at Ripple in Worcestershire.
Johann Friedrich Overbeck (* 3. Juli 1789 in Lübeck; † 12. November 1869 in Rom) war ein deutscher Maler, Zeichner und Illustrator. Er gilt als Protagonist der nazarenischen Kunst.
Friedrich Overbeck war ein Sohn des Lübecker Bürgermeisters, Senators, Domherrn, Juristen und Dichters („Komm, lieber Mai, und mache“) Christian Adolph Overbeck (1755–1821) und Enkel des Juristen Georg Christian Overbeck (1713–1786) und dessen Frau Eleonora Maria Jauch (1
Overbeck hatte von jeher gerne gezeichnet, und ein alter Artillerieunteroffizier namens Mau, der auch Zeichenunterricht erteilte, war sein erster Lehrer.[1] Am Michaelistag 1803 war er in die Prima des Lübecker Katharineums gekommen.[2]
Im Jahre 1804, das als das Jahr der künstlerischen Geburt Overbecks betrachtet werden darf, hatte er es, noch nicht fünfzehnjährig, durchgesetzt, dass sein Vater ihn als Schüler zu dem zu jener Zeit in Lübeck lebenden Maler Joseph Nicolaus Peroux brachte. Dieser war es, der in ihm das erste Liebesfeuer zur göttlichen Kunst entfachte
Am 6. März 1806 sein Elternhaus und damit Lübeck für immer verlassend, zog er zur Fortführung seines Studiums an die Akademie der bildenden Künste nach Wien. Dort lehrte Heinrich Friedrich Füger. Aus Unzufriedenheit mit dem an der Akademie gelehrten Klassizismus brach Overbeck 1810 sein dortiges Studium ab und zog gemeinsam mit Franz Pforr und Ludwig Vogel nach Rom.
732–1797).
Schon in Wien hatten die Freunde 1809 nach dem Vorbild der mittelalterlichen Lukasgilden den Lukasbund gegründet, eine Gruppe von Künstlern, die sich der Erneuerung der Kunst im Geist des Christentums aus der Wiederentdeckung alter italienischer und deutscher Kunst heraus widmete. Zu ihnen stießen Philipp Veit und Peter Cornelius] Sie lebten in klösterlicher Gemeinschaft in Sant’Isidoro am Pincio in Rom. Unter dem Einfluss von Kardinal Pietro Ostini konvertierte Overbeck im April 1813 zur römisch-katholischen Kirche.
Ihre Bezeichnung als Nazarener wegen ihrer Haartracht war zunächst spöttisch gemeint, die Bezeichnung „nazarenische Kunst“ wurde aber allgemein gebräuchlich. 1816/17 Durchbruch mit der Ausmalung der Casa Bartholdy, der Residenz des preußischen Gesandten Jakob Ludwig Salomon Bartholdy, durch Overbeck, Cornelius, Veit und Friedrich Wilhelm von Schadow mit Fresken zur Josephslegende (jetzt in der Alten Nationalgalerie, Berlin). 1817–1828 Ausgestaltung des Casino Massimo durch Overbeck, Cornelius, Veit und Julius Schnorr von Carolsfeld, welcher mit August Grahl im Palazzo Caffarelli als Gast des deutschen Botschafters von Bunsen lebte. 1826 lehnte Overbeck das Angebot des bayerischen Königs Ludwig I. ab, eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste München zu übernehmen, ebenso wie ein entsprechendes Angebot der Kunstakademie Düsseldorf. 1829 lehnte er auch das Angebot der Leitung des Städelschen Kunstinstituts in Frankfurt am Main ab. Als patriarchalische Gestalt von Freunden und zahlreichen Schülern verehrt, erfüllt von tiefem Glauben, hielt der „katholische Internationalist“ (Jens Christian Jensen) bis zu seinem Tod am konservativen Ideal der frühen Jahre fest, selbst als die religiöse Malerei der Spätnazarener längst durch Nachromantik und Realismus überholt war. Seine Wertschätzung in kirchlichen Kreisen belegt ein persönlicher Besuch Papst Pius IX. in Overbecks Haus in Rom. Darüber hinaus gehörte Overbeck neben dem Maler Johann Michael Wittmer, dem Arzt Clemens August Alertz und anderen dem Vorstand der Erzbruderschaft „Campo Santo Teutonico“ in Rom an. Sein Firm-Patenkind und gleichzeitiger Schwiegersohn,[8] der römische Bildhauer Karl Hoffmann (1816–1872), schuf den Epitaph Overbecks in der Kirche San Bernardo alle Terme in Rom.
Unter Anton de Waal versuchte die Erzbruderschaft, den Leichnam auf den Campo Santo zu überführen, wo auch Overbecks Ehefrau Anna (um 1790–1853), ihre beiden früh verstorbenen Töchter und der Sohn († 1840) bestattet wurden.
William Thompson Bartoll
birth: Oct. 9, 1811 Marblehead Essex County
death: Febr. 15, 1859 Marblehead Essex County
William was the son of John and Rebecca (Thompson) Bartoll
William became a painter, like his father and grandfather before him. He was arguably the most accomplished of them all with work displayed in Abbet Hall an the Lee Museum in Marblehead, MA; the Peabody-Essex Museum, the Abby Aldrich Rockefeller Museum and elsewhere.
Utagawa Kuniyoshi (jap. 歌川 国芳; * 1798 in Edo (heute: Tokio); † 1861 ebenda) war zusammen mit Hiroshige und Kunisada einer der drei stilbildenden Meister des japanischen Farbholzschnitts am Ende der Edo-Zeit.
Utagawa Kuniyoshi wurde 1798 als Sohn des Seidenfärbers Yanagiya Kichiemon geboren. Der Überlieferung nach half er seinem Vater schon früh bei der Gestaltung von Seidenstoffen und erregte öffentliche Aufmerksamkeit, als er anlässlich eines Shinto-Festes einen von ihm selbst bemalten Baumwollkimono trug. Als Kind wurde er Yoshizō (oder Yoshisaburō) genannt, sein späterer bürgerlicher Name war Ikusa Magosaburō.
Kuniyoshis Vater war befreundet mit Toyokuni I., dem Oberhaupt der Utagawa Schule. Im Jahr 1808 scheint Kuninao (1793–1854) als Schüler des Toyokuni im Haus der Familie Kichiemon eine zeitlang gastiert zu haben. Von diesem könnte der Knabe ersten zeichnerischen Unterricht bekommen haben. Aus dem Jahr 1808 ist auch ein Zusammentreffen mit Toyokuni selbst überliefert, der den jungen Kuniyoshi für eine Zeichnung des Dämonenjägers Shōki lobte.
Einer japanischen Quelle zufolge war jedoch weder Kuninao noch Toyokuni, sondern Katsukawa Shun’ei der erste tatsächliche Zeichen- und Mallehrer Kuniyoshis. Von diesem lernte er sowohl das Zeichnen komischer und fantastischer Szenen als auch die Darstellung der Szenen und Schauspieler des beliebten Kabuki-Theaters. Im Jahr 1811 nahm ihn schließlich Toyokuni als Lehrling in seiner Werkstatt an, die in dieser Zeit führend in der Gestaltung der Kabuki- und Schauspielerporträtdrucke und der Illustration der zeitgenössischen Unterhaltungsliteratur war. Seine Lehrzeit war 1814 beendet und damit erhielt er von seinem Lehrmeister den Künstlernamen Kuniyoshi.
Im selben Jahr illustrierte er eine Buchausgabe des Chushingura; aus dem folgenden Jahr sind einige wenige Kabuki-Drucke und zwei weitere Buchillustrationen von ihm bekannt. 1816 gab es nur eine Buchillustration. 1817 erschien nichts aus seiner Hand und in der Zeit von 1818 bis 1826 fanden sich nur vereinzelt Verleger, für die er Triptychen mit heroischen Szenen (Musha-e) aus der japanischen Geschichte gestalten konnte.
Seinen Lebensunterhalt konnte Kuniyoshi in diesen Jahren in keiner Weise mit dem Entwurf von Farbholzschnitten bestritten haben. Der Legende nach fristete er mit dem Verkauf und der Reparatur von Bodenmatten sein Leben in ärmlichsten Verhältnissen. Er soll um 1817 herum ein für ihn demütigendes Zusammentreffen mit seinem ehemaligen Mitschüler Kunisada gehabt haben, das ihn zu verstärkten künstlerischen Anstrengungen angespornt habe, da er sich diesem immer überlegen gefühlt habe. Tatsächlich war Kunisada 12 Jahre älter als Kuniyoshi und war 1811, als dieser in die Werkstatt Toyokunis eintrat, bereits als Buchillustrator und Designer von Farbholzschnitten anerkannt und konnte von dieser Tätigkeit leben. Kunisada hätte keinen Grund zur Rivalität oder keinen Anlass zur Demütigung gehabt. Kuniyoshis Entwürfe hatten einfach keinen Anklang beim Publikum gefunden.
Bis 1826 muss er als Handwerker in einem anderen Beruf tätig gewesen sein, möglicherweise wieder im Geschäft seines Vaters, und nebenbei einige Entwürfe für Farbholzschnitte gezeichnet haben. Auf jeden Fall war er in der Lage, um 1820 selbst eine Familie zu gründen; überliefert ist seine Hochzeit mit einer Angehörigen aus der Iwara-Familie (andere Angabe: Saitō-Familie).
1827 erteilte ihm der Verleger Kagaya Kichibei den Auftrag zum Entwurf für zunächst fünf Blätter aus der Serie „Die 108 Helden des Suikoden“. Sie wurden der erste große Publikumserfolg Kuniyoshis. Die Drucke verkauften sich gut, die Serie wurde tatsächlich vollständig herausgegeben und alle Blätter wurden von Kuniyoshi gezeichnet. Der Durchbruch war geschafft. Kurze Zeit später erschien eine ähnlich umfangreiche Serie mit japanischen Helden und Heldinnen des Suikoden. Es folgten Aufträge für weitere Heldendarstellungen, Buchillustrationen, darunter auch Shunga-Produktionen, und Darstellungen der Chushingura Erzählung. In den 1830er Jahren erstreckte sich seine künstlerische Tätigkeit dann auch auf die Gestaltung von Bijin-ga, Kabuki-Szenen und einigen Landschaftsdrucken. Er erhielt Aufträge für die Gestaltung von Surimono und wohl auch die ersten Aufträge von Angehörigen des Handelsbürgertums zur Ausführung von Gemälden. Vor allem letzteres war mit erheblichen Einnahmen verbunden, denn die Honorare für solche Bilder entsprachen in etwas dem Jahreseinkommen eines Handwerkers, wohingegen mehrere Entwürfe für Farbholzschnitte pro Tag nötig waren, um ein Tageseinkommen zu sichern.
Bis 1842 war Kuniyoshis Stellung in der Welt des Ukiyo-e endgültig etabliert, jetzt zählte er zusammen mit Kunisada und Hiroshige zu den drei führenden Meistern dieses Genres in Edo.
Die Tenpō-Reformen von 1842 brachten, wie für den gesamten Markt des Farbholzschnitts, auch für Kuniyoshi einschneidende Veränderungen mit sich. Schauspiel-, Schauspielerporträt- und die Darstellung der Prostituierten, Kurtisanen und Geisha waren verboten worden und die Künstler waren daher gezwungen, sich anderen Inhalten zuzuwenden. In den ersten Jahren nach den Reformen entwarf Kuniyoshi Scherzbilder, einen Teil seiner Katzenbilder, Drucke zur „Erziehung und Erbauung“ von Hausfrauen und Kindern, und Drucke japanischer Helden zur Stärkung von „Sitte, Moral und Tugend“ in der Bevölkerung.
Im Zusammenhang mit den Reformen wurde Kuniyoshi 1843 von den Behörden wegen eines Druckes verwarnt, da in ihm eine verbotene Karikatur des Shōgun Iyeyoshi und seines ersten Ministers Nichizen gesehen worden war. Die Druckplatten wurden zerstört, weitere Folgen hatte der Vorfall für Kuniyoshi nicht.
In der zweiten Hälfte der 1840er Jahre zeichnete er (unter vielem anderen) zusammen mit Kunisada und Hiroshige die Entwürfe für zwei große Serien, die offensichtlich den Bestimmungen der Zensurbehörden widersprachen, da sie aktuelle Kabuki-Schauspieler unter dem Vorwand der Darstellung heroischer bzw. mystischer Begebenheiten zeigten. Die Behörden griffen nicht ein und gegen Ende der 1840er/Anfang der 1850er hatten sich Verleger, Künstler und das Publikum entgegen dem bestehenden Verbot die erneute Darstellung des Kabuki-Theaters und dessen Schauspieler ertrotzt. Immerhin hatten diese Drucke vor dem Verbot ca. 80 Prozent der gesamten Produktion an Farbholzschnitten ausgemacht, und diese waren es, die vor allem von den einfachen Einwohnern Edos gekauft wurden und das tägliche Brot der Künstler ausmachten.
Bis 1855 war Kuniyoshi auf allen Gebieten des Farbholzschnitts in großem Umfang tätig. Im Jahr 1853 bestätigte ein Polizeibericht, dass er über ein erhebliches Einkommen verfügte und es sich leisten konnte, dieses großzügig unter seinen Schülern zu verteilen. Aus den Jahren um 1850 sind aus seinem Schaffen besonders noch mehrere Serien hervorzuheben, die die Helden des Chushingura darstellen. Außerdem ist bekannt, dass er Wandgemälde für verschiedene Tempel und für ein Bordell im Yoshiwara Viertel anfertigte; diese sind jedoch nicht erhalten.
Nach 1855 beschränkte sich seine Arbeit auf die Illustration einer sehr umfangreichen Hideyoshi-Biographie und dem Entwurf einiger weniger Helden-Triptychen. Seit diesem Jahr, dem Jahr des großen Erdbebens in Edo, schien er ernsthaft erkrankt gewesen zu sein. Nach westlichem Kalender verstarb er am 14. April 1861 geplagt von der Gicht. Begraben wurde er beim Daisenji-Tempel. Zwölf Jahre nach seinem Tod ließen dort 45 seiner überlebenden Schüler eine Grabstele zu seinem Gedächtnis errichten
William Matthew Prior (May 16, 1806 – January 21, 1873) was an American folk artist known for his portraits, particularly of families and children.
he son of Captain William, a shipmaster, and Sarah Bryant Prior, William Matthew Prior was born in Bath, Maine on May 16, 1806. Prior completed his first portrait in 1823, at the age of 17 after training under Charles Codman, another Maine-based painter.
In 1840, Prior moved to East Boston, Massachusetts from his native Bath with his in-laws, notably fellow painter Sturtevant J. Hamblin, to invigorate his career as an artist.] The paintings of Prior and Hamblin, when unsigned, are so similar in style as to be indistinguishable, and are commonly attributed to the "Prior/Hamblin School". According to the 1852 directory of Boston, Prior lived at 36 Trenton Street in East Boston.[He was a follower of the preacher William Miller, who prophesied that the end of the world was imminent.] Prior wrote two books about Miller's teachings, The King's Vesture (1862) and The Empyrean Canopy (1868).
Prior died on January 21, 1873 and was interred at Woodlawn Cemetery in Everett, Massachusetts.
About 1,500 portraits are attributed to Prior.] His works are in many museums and institutions around the United States including the Harvard Art Museums, Museum of Fine Arts, Boston, and the National Gallery of Art.
Prior is the subject of an exhibition, Artist and Visionary: William Matthew Prior Revealed, shown at the Fenimore Art Museum, Cooperstown, New York (May 26 – December 31, 2012) and subsequently at the American Folk Art Museum in New York City (January 24 – May 26, 2013).
Helen Allingham (* 26. September 1848 als Helen Mary Elizabeth Paterson in Swadlincote bei Burton-upon-Trent; † 28. September 1926 in Haslemere, Surrey) war eine britische Genremalerin und Illustratorin.
Die Tochter eines Arztes studierte ab 1867 an der Female School of Art in London und betätigte sich in der Folge als Illustratorin von Kinderbüchern. Sie war befreundet mit Kate Greenaway. 1874 heiratete sie den viel älteren irischen Dichter William Allingham.
Helen Allingham blieb auch nach ihrer Eheschließung künstlerisch aktiv und wandte sich der Aquarellmalerei zu. Sie illustrierte Bücher wie Six to Sixteen. A Story for Girls von Juliana Horatia Ewing (1876),[1] Happy England (1903) und The Homes of Tennyson (1905). Für die Zeitschriften wie die Wochenzeitung „The Graphic“] oder die Literaturzeitschrift „Cornhill Magazine“ lieferte sie Holzschnitte.
Allingham war das erste weibliche ordentliche Mitglied der Royal Watercolour Society. Bis heute beliebt sind ihre etwas süßlichen ländlichen Idyllen, besonders die romantisierende Darstellung ärmlicher Cottages in Surrey und Sussex. Das Andenken der Künstlerin wird von der Helen Allingham Society gepflegt.
Rosa Bonheur (* 16. März 1822 in Bordeaux, Frankreich; † 25. Mai 1899 in Thomery, Frankreich) war eine französische Tiermalerin des Naturalismus bzw. des Realismus.
Rosa Bonheur stammte aus einer Künstlerfamilie. Sie war das älteste von vier Kindern des Zeichners und Landschaftsmalers Raymond Bonheur und seiner Frau Sophie Marquis. Ihr Bruder war der Landschaftsmaler Auguste Bonheur (1824–1884). Sie erlernte das Zeichnen und Malen bei ihrem Vater und spezialisierte sich bereits in frühen Jahren auf die Tiermalerei.
Im Unterschied zu vielen anderen zeitgenössischen Künstlerinnen und entgegen gesellschaftlicher Rollenfestlegung begriff sie das Malen als Beruf und bestimmte ihre Rolle, dem männlichen Modell folgend, von ihrer beruflichen Tätigkeit ausgehend. Zu ihrer Zeit malten Frauen bevorzugt kleinere Tiere wie Vögel und Fische, Bonheur jedoch konzentrierte sich auf Rinder und Pferde.
Zu diesem Selbstverständnis trugen die Auffassungen ihres Vaters bei, der als Anhänger der frühsozialistischen saint-simonistischen Bewegung Männern und Frauen gleiche Fähigkeiten und Rechte zusprach und erklärte, dass der gesellschaftliche Fortschritt entscheidend von der Emanzipation der Frau abhinge. Neben ihrer Erziehung gehörten zum Selbstverständnis der Malerin ihre künstlerischen und wirtschaftlichen Erfolge. Linda Nochlin (2008) sah in ihr eine Ausnahmeerscheinung im von Männern dominierten Kunstbetrieb des 19. Jahrhunderts. Als emanzipierte homosexuelle Frau konnte sie ihr Leben jenseits des traditionellen Rollenmodells weitgehend selbstbestimmt gestalten.
1829 zog die Familie nach Paris, wo Bonheur mit ihren beiden Brüdern auf eine Jungenschule geschickt wurde. Nach dem Tod der Mutter im Jahre 1833 arbeitete sie vorübergehend in einer Schneiderei und half anschließend einem befreundeten Ehepaar beim Kolorieren. Dem Wunsch ihres Vaters entsprechend besuchte sie ein Mädchenpensionat, aus dem sie aber bereits 1835, mit 13 Jahren, als schwer erziehbar entlassen wurde. Seitdem arbeitete sie tagsüber im Atelier des Vaters, während dieser als Zeichenlehrer unterwegs war. Zu dieser Zeit erhielt sie wie ihre Geschwister Zeichenunterricht durch den Vater und kopierte im Louvre Werke, unter anderem von Nicolas Poussin, Salvator Rosa und dem holländischen Tiermaler Paulus Potter.
Bereits seit 1841 durfte sich Bonheur an den Ausstellungen im Pariser Salon beteiligen. Bekannt wurde sie durch ihr Bild Bœufs et Taureaux, race du Cantal, das im Salon von 1848 gezeigt wurde. Es folgte im Salon des nächsten Jahres das Bild Ackerbau in Nevers (2011 im Musée d’Orsay, Paris). Der Pferdemarkt im Salon 1853 machte sie berühmt. Königin Victoria ließ sich 1855 das Bild privat in Windsor Castle vorführen. Erst danach stand es dem Kunsthändler Ernest Gambart, der es für 40.000 Franc erworben hatte, wieder zur Verfügung.[3] Schließlich erwarb der nordamerikanische Eisenbahnkönig Cornelius Vanderbilt das Bild, das ihren Weltruhm begründet hatte, und schenkte es dem New Yorker Metropolitan Museum of Art wo es sich auch heute noch befindet. Daneben existieren mehrere weitere Versionen.[5]
Ihr Galerist, der Belgier Ernest Gambart, organisierte 1856 eine Tour durch England und Schottland mit den Arbeiten Bonheurs und stellte sie nicht nur der Königin, sondern auch allen wichtigen Sammlern vor. Von dieser Reise brachte Bonheur neben vielen Skizzen von neuen Schaf- und Rinderzüchtungen auch lebende Tiere für ihre Menagerie im Hinterhof ihres Ateliers mit. Sie hielt sich für ihre Studien nicht nur Tiere im Atelier, sondern beobachtete auch Tiere in Tiergärten und umliegenden Wäldern, zog für Studien an Kühen, Schafen und Ziegen 1845 für einige Monate auf einen Bauernhof und arbeitete − wie auch sonst häufig in Männerkleidung – auf Pferdemärkten und in Schlachthöfen. Wichtig war ihr die naturalistische bzw. realistische Darstellung jenseits jeder Idealisierung oder Verniedlichung.
Bonheur galt nunmehr als eine der wichtigsten Malerinnen ihrer Zeit und war nicht nur künstlerisch, sondern auch wirtschaftlich sehr erfolgreich. Für kaufkräftige Auftraggeber in England und Amerika fertigte sie vor allem Tierporträts. Da immer mehr Besucher in ihr Atelier strömten, zog sie sich auf ein kleines Schloss zurück, das Château de By am Rand des Waldes von Fontainebleau, das sie sich von den Erlösen ihrer Malerei zusammen mit ihrer Freundin und Partnerin Nathalie Micas gekauft hatte. Zu ihren Besuchern dort zählte unter anderem Kaiserin Eugénie, die ihr 1865 das ihr verliehene Kreuz der Ehrenlegion überreichte. Am 5. Mai 1894 erhielt Bonheur, als erste Frau überhaupt, das Offizierskreuz der Ehrenlegion.[] Bonheur wurde darüber hinaus vielfach international ausgezeichnet.
Zunehmend wuchs Bonheurs Interesse für Großwild. 1880 schenkte Gambart ihr zwei Zirkuslöwinnen, aus den USA erhielt sie Wildpferde. Mit einer Sondererlaubnis malte die Siebenundsechzigjährige die Bisons und Mustangs bei der Wildwest-Show von Buffalo Bill Cody zur Pariser Weltausstellung 1889. Ein Porträt Codys hoch zu Ross nutzte dieser zur Eigenwerbung und bedankte sich für die Werbung, indem er auf ihrem Landsitz ihre Wildpferde zuritt. Bonheur ließ sich durch Buffalo Bills Show zu ihrem Bild Indianer auf Bisonjagd inspirieren.[7]
In ihrem letzten Lebensjahr freundete sie sich mit der amerikanischen Malerin Anna Elizabeth Klumpke an, die sie mehrfach porträtierte. Rosa Bonheur starb mit 77 Jahren und wurde in Paris beigesetzt. In ihrem Testament hatte sie Klumpke zu ihrer Erbin und Nachlassverwalterin bestimmt. Diese übergab 1933 dem französischen Staat zahlreiche Werke von Rosa Bonheur, die im Musée de l’Atelier de Rosa Bonheur auf Château de By zu sehen sind, wo Bonheur während der letzten 40 Jahre ihres Lebens arbeitete.[9] Klumpke schrieb ihre Biografie (1909) in der Ich-Form.
Władysław Ślewiński (* 1. Juni 1856[ in Białynin bei Mikołajów; † 24. März oder 27. März 1918 in Paris) war ein polnischer Maler und Gründungsmitglied der Bewegung Młoda Polska.
Ślewiński stammte aus einer wohlhabenden polnischen Landbesitzerfamilie und besuchte die Schule in Radom. Während eines Landwirtschaftsstudiums besuchte er auch kurz die Warschauer Zeichenschule von Wojciech Gerson. Später bewirtschaftete er den mütterlichen Familienbesitz Pilaszkowice in der Nähe von Lublin. Wegen Auseinandersetzungen mit den russischen Finanzbehörden und angedrohter Enteignung floh er 1888 nach Paris[1]. Dort wohnte er zunächst mit dem Maler Zygmunt Andrychiewicz zusammen, der sein erster Mentor werden sollte. Ślewiński studierte an der Académie Colarossi, wo er Paul Gauguin kennenlernte. Der Maler und dessen Kunstwerke machten einen tiefen Eindruck auf Ślewiński, in dessen Folge er beschloss selber Künstler zu werden. Er schloss sich Gauguin an, nach einer gemeinsamen Zeit in Paris folgte er ihm 1889 nach Pont-Aven und Le Pouldu in der Bretagne. In dieser Zeit entstanden Meereslandschaften (vor Allem mit den bretonischen Klippen). 1891 malte Gauguin ein Porträt von Ślewiński und schenkte es ihm.
Ślewiński stellte 1895 und 1896 in Paris auf dem Salon des Indépendants sowie 1897 und 1898 in der Galerie Georges Thomas aus. 1898 reiste er nach Spanien. Auf einer Rückreise von Polen nach Frankreich machte er 1907 mit seiner russischen Frau Eugenia Szewcow für einige Monate in München Station. Dort kam er in der Osterzeit 1908 in Kontakt mit den Malern Jan Verkade[Marianne von Werefkin und Alexej Jawlensky[. Letzteren beeinflusste er malerisch maßgeblich. Von 1905 bis 1910 hielt er sich in Krakau, Poronin, Lemberg und Warschau auf. 1908 wurde er als Professor an die Warschauer Kunstakademie berufen. Er legte das Amt bereits kurze Zeit später nieder, um in Warschau eine eigene Malschule in der Polna-Straße zu eröffnen. 1910 kehrte er wieder nach Frankreich zurück.